#gewissen
Text
Möge ein Feuer in deinem inneren jedes mal entfachen, wenn du meinen Namen hörst, um dich daran zu erinnern, dass du ein Herz, welches die reinste Absicht mit dir hatte auf dem Gewissen hast.
#eigenes#sloth#herzschmerz#liebe#verliebt#verletzt#vermissen#trennung#schmerz#enttäuscht#Gewissen#ohne dich#du fehlst#keine zukunft#Vergangenheit#slothi#1123
15 notes
·
View notes
Text
The man who has a conscience suffers whilst acknowledging his sin. That is his punishment.
-Fyodor Dostoyevsky, Crime and Punishment
Comment: There are people who don’t feel like this: narcissists or sociopaths. They always blame others for their sins or do not feel guilt at all.
#quotes#zitate#fyodor dostoevsky#fjodor dostojewski#crime and punishment#schuld und sühne#conscience#gewissen#books#bücher
16 notes
·
View notes
Text
f
Ich weiß was du von dir halten würdest,
wenn du wüsstest,
wie sehr ich mich in den letzten Monaten zugedröhnt hab.
Du würdest denken,
dass es nur an dir liegt,
weil ich mit dir zusammen das erste mal den Schnee nahm.
Aber ich wollte dieses Gefühl nicht verlieren,
hab dir damals versichert den Scheiß zu lassen.
Aber ich konnte meine Finger nicht von lassen,
mir nichts mehr sagen lassen.
Es tut mir weh,
dass du denken würdest dass du die Schuld trägst,
du würdest die Verantwortung auf dich nehmen.
Deswegen würde ich dir das nie erzählen.
Als du mich warntest was alles noch passieren kann,
mir von deiner Vergangenheit erzählt hast,
da hab ich dich überhört,
bis ich völlig auf Entzug mich nicht mehr bewegen konnte,
meine Beine keine Treppen steigen konnten,
ich nicht aus dem Bett alleine hoch konnte.
Es würde mir nicht mein Gewissen erleichtern,
dir das jetzt zu erzählen,
es würde es nur noch mehr belasten.
Also lass ich dich einfach weiterleben,
während ich nicht weiß, ob ich das alles überlebe.
- iamthedisorder
2 notes
·
View notes
Text

Ohne schlechtes Gewissen chillen 😌
5 notes
·
View notes
Quote
Das Gewissen ist ein Spiegel, vor dem ein Affe sich quält; jeder putzt sich, wie er kann, und geht auf seine eigene Art auf seinen Spaß dabei aus.
Georg Büchner: “Werke und Briefe”, S.86
4 notes
·
View notes
Text
Bin ich drauf und allein setzt gleich wieder das schlechte Gewissen ein….
#sprüche#leben#angst#liebe#gedanken#panik#drogen#kaputt#gefühle#freundschaft#drauf#schlechtes Gewissen#Gewissen#allein#Hilfe
12 notes
·
View notes
Text
Schuld.
Ich hasse es. Schuld. Ich hasse es, dass ich immer denke, ich wäre schuld. Ich hasse es, zu denken, Schuld wäre gleichzustellen mit ungerechtem Verhalten, weil in dieser Welt keiner immer gerecht handelt. Das hasse ich auch.
Ich hasse es, dass wir alle Schuld tragen und trotzdem andauernd den anderen ihre eigene vorwerfen. Ich hasse, dass Schuld so ungleichmäßig verteilt ist, weil sie so subjektiv ist. Ich hasse es, immer in meiner eigenen Auffassung von Schuld zu ertrinken, weil meine eigene Auffassung von Schuld fast immer erst mal bei mir selbst liegt. Ich hasse es, dass das Überhand gewinnt und was Menschen deshalb für eine Macht über mich haben. Ich hasse auch ein bisschen Menschen, die die Schuld nie bei sich sehen können, obwohl ich sie auch ein bisschen um ihre Leichtigkeit beneide. Ich hasse, dass ich kein Problem damit habe, die Schuld bei anderen zu suchen, wenn sie nicht mich verletzt haben, sondern jemandem, den ich liebe und dass es mir bei mir aber so schwerfällt. Ich hasse dass man mir erst sagen muss, dass ich ein guter Mensch bin, damit meine eigene Auffassung von Schuld mich nicht auffrisst. Ich hasse das, was mich in der Vergangenheit zu einem Menschen gemacht hat, der sich so verzweifelt an die eigene Bösartigkeit klammert und gleichzeitig alles daran setzt, sein Bestes zu geben, um es nicht zu sein. Ich kann nicht aufhören, gut sein zu wollen und gleichzeitig nicht damit, zu denken, ich wäre schlecht. Ich hasse es, blind zu sein, blind und gutgläubig was die Leute angeht, die mich verletzten. Ich will, dass sie selbst erkennen, was sie getan haben, so wie ich es tun würde, aber so läuft das nicht. Nur weil ich die Schuld bei mir suche, heißt das nicht, dass es die anderen auch machen, egal ob sie es vielleicht tun sollten.
Wenn ich verletzt bin, muss ich aufhören, Schuld zu suchen. Egal ob bei mir oder bei jemand anderem. Ich muss lernen, dass es gut und genug ist, immer mein Bestes zu geben und mir mit ein bisschen Empathie darüber im Klaren zu sein, was ich im Anderen auslöse, aber nicht so viel, dass ich mich selbst hasse. Ich will nicht mehr hassen. Nicht die Schuld, nicht irgendjemanden, der mich verletzt, nicht mich, vor allem nicht mich.
#schuld#schuldig#verletzt#verletzlich#verletzen#schuld suchen#unglücklich#selbstkritik#selbstkritisch#selbstvertrauen#gewissen#gedanken#meine gedanken#poesie#pilosophie#psychologie#deutsch#text#my text#hoffnung#fault#not my fault#responsible#hurt#search fault#unhappy#self criticism#self critical#self-confidence#self love
3 notes
·
View notes
Text
Was passiert hier ?
Was passiert hier eigentlich ?
Warum lassen wir so viele Menschen in Stich ?
Siehe das schaukelnde Europa im Kriege
Höre das Flehen der Mütter über des Todes Wiege
Hunger, Tod, Leid und Krankheit
Das Missen der echten Menschen Einheit
Das Mute weiche vor der Feigheit
Und Gewissen wie Rechtschaffenheit weiche der Gerechtigkeit
An Mellias Grenzen stirbt die Freiheit und das Recht
In der Türkei verletzen Beamte das Recht vom anderen Geschlecht
In Kiew schlagen Raketen ein auf die Demokratie
In Moskau singen sie Oden der Autokratie
In Elmau debattieren sie über Wohlstand
Doch wir alle fallen in Ohnmacht
Überall die selben Lügen
Nur versteckt hinter dem echten Betrügen
Wir Deutsche machen Urlaub auf Rügen
Während wir alle Folgen der Werbung Lügen
Wir leben in einer Parallelwelt
In der es gebe keinen Held
Nur das Interesse im Geld
Dicke Bäuche tragen wir
Dürre Knochen vor den Grenzen zu dir
Wachet auf und seht herbei
Was das Wohle der Schaffenheit gesegnet sei
Nichts ist Umsonst aber alles vergänglich
Aber die Moral sei empfänglich
Leben wir human
Das sind wir schuldig
Der Natur gepriesen wie des nächsten Menschen zu huldigen
2 notes
·
View notes
Text
Julian Assange ist das "Gewissen unserer Pressefreiheit"
0 notes
Text
William Wilson

William Wilson ⋆ Edgar Allan Poe ⋆ Doppelgänger ⋆ Gewissen
Erlaubt, dass ich mich William Wilson nenne. Das reine, schöne Blatt hier vor mir soll nicht mit meinem wahren Namen befleckt werden, der meine Familie mit Abscheu und Entsetzen, ja mit Ekel erfüllt.
Haben nicht die empörten Winde seine Schmach bis in die entlegensten Länder der Erde getragen? Verworfenster aller verlassenen Verworfenen, bist du für die Welt nicht auf immer tot? Tot für ihre Ehren, ihre Blumen, ihre goldenen Hoffnungen? Und hängt sie nicht ewig zwischen deinem Hoffen und dem Himmel – die dichte, schwere, grenzenlose, graue Wolke?
Selbst wenn ich es könnte, würde ich es doch vermeiden, von dem unaussprechlichen Elend und der unverzeihlichen Verdorbenheit meiner letzten Jahre hier zu reden. Von dieser Zeit – von diesen letzten Jahren, die meine Seele so mit Schändlichkeit belastet, will ich nur insofern reden, als ich versuchen will, hier niederzulegen, was mich so in die Tiefen des Bösen hinein getrieben.
Gewöhnlich sinkt der Mensch nur nach und nach. Von mir fiel alle Tugend in einem Augenblick ab, gleich einem Mantel. Aus verhältnismäßig geringer Schlechtigkeit wuchs ich mit Riesenkraft zu den Ungeheuerlichkeiten eines Heliogabalus auf. Welcher Zufall – welches eine Ereignis dies veranlasste, will ich euch jetzt berichten.
Mir naht der Tod, und der Schatten, der ihm vorhergeht, hat meinen Geist sanftmütig gemacht. Da ich nun das düstere Tal durchschreiten muss, verlangt es mich nach dem Mitgefühl, fast hätte ich gesagt, nach dem Mitleid meiner Menschenbrüder. Ich möchte sie gern davon überzeugen, dass ich in gewissem Grad der Sklave von Umständen gewesen bin, die außerhalb menschlicher Berechnung liegen.
Ich möchte, dass sie inmitten der Einzelheiten, die ich hier wiedergeben will, in all der Wüste von Fehl und Verirrung, hie und da wie eine Oase die unerbittliche Schicksalsfügung fänden. Ich möchte, dass sie eingeständen, dass – wie sehr auch wir Menschen von Anbeginn der Welt versucht worden – nicht einer so versucht wurde wie ich und gewisslich nicht einer so unterlag. Lebte ich nicht vielleicht in einem Traum und sterbe als Opfer geheimer, schrecklicher Kräfte, die in uns wirken?
Ich bin der Abkömmling eines Geschlechts, das sich von jeher durch eine starke Einbildungskraft und ein leicht erregbares Temperament auszeichnete; und schon in frühester Kindheit bewies ich, dass ich ein echter Erbe dieser Familienveranlagung war. Je mehr ich heranwuchs, desto mehr entwickelten sich jene Eigenschaften, die aus vielen Gründen meinen Freunden zu einer Quelle der Besorgnis und mir selbst zum Kummer wurden.
Ich wurde eigensinnig, ein Sklave all meiner wunderlichen Leidenschaften. Meine willensschwachen Eltern, die im Grunde an denselben Fehlern litten wie ich, konnten wenig tun, um meine bösen Neigungen zu unterdrücken.
Einige schwache und unrichtig angefangene Versuche endeten für sie mit einem vollkommenen Misserfolg und stellten infolgedessen für mich, einen glänzenden Triumph dar. Von nun ab war mein Wort Gesetz im Haus, und in einem Alter, in dem andere Kinder fast noch am Gängelband hängen, war ich in Tun und Lassen mein eigener Herr.
Meine ersten Erinnerungen an einen regelrechten Unterricht sind mit einem großen, weitläufigen Haus im elisabethanischen Stil in einem düsteren Städtchen Englands verknüpft, wo es eine große Menge riesiger, knorriger Bäume gab und alle Häuser uralt waren. Ja wirklich, es war ein Städtchen wie in einem stillen Traum; alles dort wirkte ehrwürdig und beruhigend.
Jetzt, da ich das schreibe, fühle ich wieder im Geist die erfrischende Kühle seiner tiefschattigen Alleen, atme den Duft seiner tausend Büsche und Hecken und erschauere von neuem unter dem tiefdunklen Ton seiner Kirchenglocken, die Stunde für Stunde mit plötzlichem Dröhnen die Sonnennebel durchbrachen, in die der verwitterte gotische Kirchturm friedvoll eingebettet lag.
Das Verweilen bei diesen Einzelheiten der Schule und ihrer Umgebung bereitet mir vielleicht die einzige Freude, deren ich jetzt noch fähig bin. Mir, der ich so tief im Elend stecke, der ich die Wirklichkeit so dunkel lastend empfinde, wird man verzeihen, dass ich geringe und zeitweilige Erholung suche im Verweilen bei solchen Einzelheiten, die überdies, so unbedeutend und vielleicht sogar lächerlich sie scheinen mögen, in meiner Erinnerung von großer Wichtigkeit sind, da sie zu einer Zeit und einem Ort in Beziehung stehen, in denen mir die erste unklare Kunde wurde von dem dunklen Geschick, das mich später so ganz umschattete. Erlaubt mir also diese Rückerinnerungen.
Das Haus, ich sagte es schon, war uralt und von weitläufiger, unregelmäßiger Bauart. Das Grundstück war sehr umfangreich und von einer hohen festen Backsteinmauer umschlossen, die oben mit Mörtel bestrichen war, in dem Glassplitter steckten.
Dieser Festungswall, diese Gefängnismauer bildete die Grenze unseres Reichs, das wir nur dreimal in der Woche verlassen durften: einmal Samstagnachmittag, wenn wir, von zwei Unterlehrern begleitet, gemeinsam einen kurzen Spaziergang in die angrenzenden Felder machen durften, und zweimal des Sonntags, wenn man uns in Reih und Glied zum Morgen- und Abendgottesdienst in die Stadtkirche führte.
Der Pfarrer dieser Kirche war unser Schulvorsteher. Mit welch tiefer Verwunderung, ja Ratlosigkeit pflegte ich ihn von unserem entlegenen Platz auf dem Chor aus zu betrachten, wenn er mit feierlich abgemessenen Schritten zur Kanzel empor stieg!
Dieser heilige Mann, mit der so gottergebenen Miene, im strahlenden Priestergewand, mit sorgsam gepuderter, steifer und umfangreicher Perücke – konnte das derselbe sein, der mit saurer Miene und tabakbeschmutzter Kleidung, den Stock in der Hand, drakonische Gesetze ausübte? Oh ungeheurer Widerspruch, oh ewig unbegreifliches Rätsel!
In einem Winkel der gewaltigen Mauer drohte ein noch gewaltigeres Tor. Es war mit Eisenstangen verriegelt und von Eisenspießen überragt. Welch tiefe Furcht flößte es ein! Es öffnete sich nie, außer für die drei regelmäßig wiederkehrenden wöchentlichen Ausgänge; dann aber fanden wir in jedem Kreischen seiner mächtigen Angeln eine Fülle des Geheimnisvollen, eine Welt von Stoff für ernstes Gespräch oder stumme Betrachtung.
Das zweite Grundstück war von unregelmäßiger Form und hatte manche umfangreiche Plätze. Drei oder vier der größten bildeten den Spielhof. Er war eben und mit feinem harten Kies bedeckt; weder Bäume noch Bänke standen dort. Natürlich lag er in der Nähe des Hauses.
Vor dem Haus lag ein schmaler Rasenplatz, mit Buchsbaum und anderem Strauchwerk eingefasst; diesen geheiligten Teil überschritten wir jedoch nur selten, etwa bei Ankunft in der Schule, oder bei der endgültigen Abreise, oder wenn ein Verwandter oder Freund uns eingeladen, die Weihnachts- oder Sommerferien bei ihm zu verleben.
Aber das Haus! – Was war es für ein komischer alter Bau! Für mich ein wahres Zauberschloss! Seine Winkel und Gänge, seine unbegreiflichen Ein- und Anbauten nahmen kein Ende. Es war jederzeit schwierig anzugeben, in welchem seiner beiden Stockwerke man sich gerade befand. Man konnte sicher sein, von einem Zimmer zum anderen immer ein paar Stufen hinauf oder hinunter zu müssen.
Dann gab es zahllose Seitengänge, die sich trennten und wieder vereinigten, oder sich wie ein Ring in sich selbst schlossen, so dass der klarste Begriff, den wir vom ganzen Haus hatten, beinahe der Vorstellung gleichkam, die wir uns von der Unendlichkeit machten. Während der fünf Jahre, die ich hier verlebte, konnte ich nie mit Sicherheit feststellen, in welchem entlegenen Teile der kleine Schlafsaal lag, der mir und etlichen achtzehn oder zwanzig anderen Schülern zugewiesen war.
Das Schulzimmer schien mir der größte Raum im Haus – ja, in der ganzen Welt! Es war sehr lang, schmal und auffallend niedrig, mit spitzen, gotischen Fenstern und einer Decke aus Eichenholz. In einem entlegenen, Schrecken einflößenden Winkel befand sich ein viereckiger Verschlag von acht oder zehn Fuß Durchmesser, der während der Unterrichtsstunden das ›sanctum‹ unseres Schulvorstehers, des Reverend Dr. Bransby bildete. Dieser Verschlag war durch eine mächtige Tür wohlverwahrt, und wir wären lieber unter Martern gestorben, als dass wir gewagt hätten, in Abwesenheit des Dominus die Tür zu öffnen.
In anderen Winkeln standen zwei ähnliche Kästen, vor denen wir weniger Ehrfurcht, aber immerhin Furcht hatten. Einer derselben war das Katheder des Lehrers für die klassischen Sprachen, der andere das für den Lehrer des Englischen, der gleichzeitig Mathematiklehrer war.
Verstreut im Saal, kreuz und quer in wüster Unregelmäßigkeit, standen zahllose Bänke und Pulte, schwarz, alt und abgenützt, mit Stapeln abgegriffener Bücher bedeckt und so mit Initialen, ganzen Namen, komischen Figuren und anderen künstlerischen Schnitzversuchen bedeckt, dass sie ganz ihre ursprüngliche Form, die sie in längst vergangenen Tagen besessen haben mussten, eingebüßt hatten. Am einen Ende des Saales stand ein riesiger Eimer mit Wasser, am anderen eine Uhr von verblüffenden Dimensionen.
Eingeschlossen von den gewaltigen Mauern dieser ehrwürdigen Anstalt, verbrachte ich das dritte Lustrum meines Lebens – doch weder in Langeweile noch Unbehagen. Die überschäumende Gestaltungskraft des kindlichen Geistes verlangt keine Welt der Ereignisse, um Beschäftigung oder Unterhaltung zu finden, und die anscheinend düstere Einförmigkeit der Schule brachte mir stärkere Erregungen, als meine reifere Jugend aus dem Wohlleben, oder meine volle Manneskraft aus dem Verbrechen schöpfte.
Ich muss allerdings annehmen, dass meine geistige Entwicklung eine ungewöhnliche, ja fast krankhafte gewesen ist. Die meisten Menschen haben in reifen Jahren selten noch eine frische Erinnerung an die großen Ereignisse aus ihrer frühen Kindheit. Alles ist schattenhaft grau – wird schwach und unklar empfunden –, ein unbestimmtes Zusammensuchen matter Freuden und eingebildeter Leiden.
Mit mir war es anders. Ich muss schon als Kind mit der Empfindungskraft eines Erwachsenen alles das erlebt haben, was noch jetzt mit klaren, tiefen und unverwischbaren Schriftzügen, wie die Inschriften auf den karthagischen Münzen, in meinem Gedächtnis eingegraben steht.
Und doch, wie wenig – wenig vom Standpunkt der Menge aus – gab es, was der Erinnerung wert gewesen wäre! Das morgendliche Erwachen, der abendliche Befehl zum Schlafengehen, der Unterricht; die jeweiligen schulfreien Nachmittage mit ihren Streifzügen; der Spielplatz mit seiner Kurzweil, seinem Streit, seinen kleinen Intrigen – all dieses, was meinem Geist wie durch einen Zauber lange Zeit ganz entrückt gewesen, war dazu angetan, eine Fülle von Empfindung, eine Welt reichen Geschehens, eine Unendlichkeit vielfältiger Eindrücke und Leidenschaften zu erwecken. ›O le bon temps, que ce siècle de fer!‹
Es ist Tatsache: mein feuriges, begeistertes, überlegenes Wesen zeichnete mich vor meinen Schulkameraden aus und hob mich nach und nach über alle empor, die nicht etwa bedeutend älter waren als ich selbst – über alle, mit einer Ausnahme!
Diese Ausnahme war ein Schüler, der, obwohl er kein Verwandter von mir war, doch den gleichen Vor- und Zunamen trug wie ich – ein an sich unbedeutender Umstand. Denn ungeachtet meiner edlen Abkunft trug ich einen Namen, der in unvordenklichen Zeiten durch das Recht der Verjährung jedermann freigegeben worden sein mochte.
Ich habe mich also hier in meiner Erzählung William Wilson genannt – ein Name, der von meinem wirklichen Namen nicht allzu sehr abweicht. Von allen Kameraden, die bei unseren Spielen meine ›Bande‹ bildeten, wagte es mein Namensvetter allein, sowohl im Unterricht als auch in Sport und Spiel mit mir zu wetteifern, meinen Behauptungen keinen Glauben zu schenken, sich meinem Willen nicht unterzuordnen – kurz, sich in allem gegen meine ehrgeizige Oberherrschaft aufzulehnen.
Wenn es aber auf Erden einen überlegenen und unbeschränkten Despotismus gibt, so ist es der, den der Herrschergeist eines Knaben auf seine weniger willensstarken Gefährten ausübt.
Wilsons Widersetzlichkeit war für mich eine Quelle der Verwirrung, um so mehr, als ich trotz der prahlerischen Großtuerei, mit der ich ihn und seine Anmaßungen vor den anderen behandelte, ihn im geheimen fürchtete und annehmen musste, dass nur wahre Überlegenheit ihn befähige, sich mit mir zu messen; mich aber kostete es beständige Anstrengung, nicht von ihm überflügelt zu werden.
Doch wurde seine Ebenbürtigkeit in Wahrheit nur von mir selbst bemerkt; unsere Kameraden schienen in unerklärlicher Blindheit diese Möglichkeit nicht einmal zu ahnen. Auch äußerte sich seine Nebenbuhlerschaft und sein hartnäckiger Widerspruch weniger laut und aufdringlich als insgeheim.
Es hatte den Anschein, als mangele ihm sowohl der Ehrgeiz, zu herrschen, als auch die leidenschaftliche Willenskraft, sich durchzusetzen. Man konnte glauben, dass nur das launische Vergnügen, mein Erstaunen zu erwecken oder mich zu ärgern, seine Nebenbuhlerschaft veranlasse; trotzdem gab es Zeiten, wo ich voll Verwunderung, Beschämung und Trotz wahrnehmen musste, dass er neben seinen Angriffen, Beleidigungen und Widerreden eine gewisse unangebrachte und mir durchaus unerwünschte Liebenswürdigkeit, ja Zuneigung verriet. Ich konnte mir sein Betragen nur als die Folge ungeheuren Dünkels erklären, der es ja immer liebt, sich in überlegenes Wohlwollen zu kleiden.
Vielleicht war es dieser letztere Zug in Wilsons Benehmen, verbunden mit der Übereinstimmung unserer Namen und dem bloßen Zufall, dass wir beide am nämlichen Tag in die Schule eingetreten waren, was bei den oberen Klassen die Meinung verbreitet hatte, wir seien Brüder; doch pflegten sich die älteren Schüler mit den Angelegenheiten der jüngeren wenig zu befassen.
Ich habe schon vorher gesagt, dass Wilson nicht im entferntesten mit meiner Familie verwandt war. Doch wären wir Brüder gewesen, so hätten wir Zwillinge sein müssen; denn nachdem ich die Anstalt Dr. Bransbys verlassen, erfuhr ich durch Zufall, dass mein Namensvetter am 19. Januar 1813 geboren war – und dieser Umstand ist einigermaßen bemerkenswert, denn es ist genau das Datum meiner eigenen Geburt.
Es mag seltsam erscheinen, dass ich, trotz der fortgesetzten Angst, in die mich die Rivalität Wilsons versetzte, und trotz seines unerträglichen Widerspruchsgeistes, mich nicht dahin bringen konnte, ihn wirklich zu hassen. Gewiss, wir hatten fast täglich Streit miteinander, und wenn er mir dann auch öffentlich die Siegespalme überließ, so gelang es ihm doch, mich irgendwie fühlen zu lassen, dass eigentlich er es war, der sie verdiente; aber ein gewisser Stolz meinerseits und eine echte Würde seinerseits hielten uns davon ab, ernstlich miteinander zu zanken.
In unseren Charakteren jedoch gab es viel Verwandtes, und nur unser seltsamer Wetteifer war schuld daran, dass meine Gefühle für ihn nicht zu wahrer Freundschaft reiften. Es ist tatsächlich schwer, das Empfinden, das ich für ihn hatte, zu bestimmen oder zu erklären. Es war ein buntes und widersprechendes Gemisch: etwas eigensinnige Feindseligkeit, die dennoch nicht Hass war, etwas Achtung, mehr Bewunderung, viel Furcht und eine Welt rastloser Neugier. Für Seelenkenner ist es unnötig hinzuzufügen, dass Wilson und ich die unzertrennlichsten Gefährten waren.
Sicherlich lag es an diesen ganz außergewöhnlichen Beziehungen, dass ich meine Angriffe auf ihn – und es gab deren genug, sowohl offene als versteckte – in Form einer bösen Neckerei oder eines Schabernacks ausführte, als scheinbaren Spaß, der dennoch Schmerz bereitete; eine derartige Handlungsweise lag meiner Stimmung für ihn näher als etwa ausgesprochene Feindseligkeit.
Doch meine Unternehmungen gegen ihn waren keineswegs immer erfolgreich, mochte ich meine Pläne auch noch so pfiffig ausgeheckt haben; denn mein Namensvetter hatte in seinem Wesen so viel vornehme Zurückhaltung, dass er keine Achillesferse bot; wohl spottete er gern selbst, ihn aber lächerlich zu machen, war beinahe unmöglich.
Ich konnte tatsächlich nur einen wunden Punkt an ihm entdecken: es war eine persönliche Eigenheit, die vielleicht einem körperlichen Übel entsprang und wohl von jedem anderen Gegner, der nicht wie ich am Ende seiner Weisheit angelangt gewesen, geschont worden wäre. Mein Rivale hatte eine Schwäche der Sprechorgane, die ihn hinderte, seine Stimme über ein sehr leises Flüstern zu erheben. Ich verfehlte nicht, aus diesem Übel meinen armseligen Vorteil zu ziehen.
Wilson dankte mir das auf mannigfache Weise, und besonders eine Form der Rache hatte er, die mich unbeschreiblich ärgerte. Woher er die Schlauheit genommen, herauszufinden, dass solche scheinbare Kleinigkeit mich kränken könne, ist eine Frage, die ich nie zu lösen vermochte; als er die Sache aber einmal entdeckt hatte, nutzte er sie weidlich aus. Ich hatte stets einen Widerwillen vor meinem unfeinen Familiennamen und meinem so gewöhnlichen, ja, geradezu plebejischen Vornamen empfunden.
Sein Klang war meinen Ohren abstoßend, und als ich am Tag meines Schulantritts erfuhr, dass gleichzeitig ein zweiter William Wilson eintrete, war ich auf diesen zornig, weil er den verhassten Namen trug, und dem Namen doppelt feind, weil auch noch ein Fremder ihn führte, der nun schuld war, dass ich ihn doppelt so oft hören musste – ein Fremder, den ich beständig um mich haben sollte, und dessen Angelegenheiten, so wie der Lauf der Schule nun einmal war, infolge der verwünschten Namensgleichheit unvermeidlicherweise mit den meinigen verknüpft und verwechselt werden mussten.
Mein durch diese Umstände hervorgerufener Verdruss nahm bei jeder Gelegenheit zu, bei der eine geistige oder leibliche Ähnlichkeit zwischen meinem Nebenbuhler und mir zutage trat. Ich hatte damals die bemerkenswerte Tatsache, dass wir ganz gleichaltrig waren, noch nicht entdeckt; aber ich sah, dass wir von gleicher Größe waren und sogar im allgemeinen Körperumriss und in den Gesichtszügen einander glichen.
Auch ärgerte mich das in den oberen Klassen umlaufende Gerücht, dass wir miteinander verwandt seien – mit einem Wort, nichts konnte mich so ernstlich verletzen, ja geradezu beunruhigen (obgleich ich diese Unruhe sorgfältig zu verbergen wusste), wie irgendein Wort darüber, dass wir einander an Geist oder Körper oder Betragen ähnlich seien.
Doch hatte ich eigentlich, mit Ausnahme des Gerüchts von unserer Verwandtschaft, keinen Grund zu der Annahme, dass unsere Ähnlichkeiten jemals zur Sprache gebracht oder überhaupt von unseren Mitschülern wahrgenommen würden. Nur Wilson selbst bemerkte sie offenbar ebenso klar wie ich; dass er darin aber ein so fruchtbares Feld für seine Quälereien fand, kann, wie ich schon einmal sagte, nur seinem ungewöhnlichen Scharfsinn zugeschrieben werden.
Die Rolle, die er spielte, bestand in einer bis ins kleinste vollendeten Nachahmung meines Ich in Wort und Ton, und er spielte sie zum Bewundern gut. Meine Kleidung nachzuahmen, war ein leichtes; meinen Gang und meine Haltung eignete er sich ohne Schwierigkeit an; abgesehen von dem Hemmnis, das ihm sein Sprachfehler in den Weg legte, entging nicht einmal meine Stimme seiner Nachahmungskunst. Wirklich laute Töne konnte er selbstredend nicht wiederholen, aber sein Tonfall war ganz der meine, und sein eigenartiges Flüstern wurde zum vollkommenen Echo meiner eigenen Stimme.
Read the full article
0 notes
Text
Mit gewissen Menschen
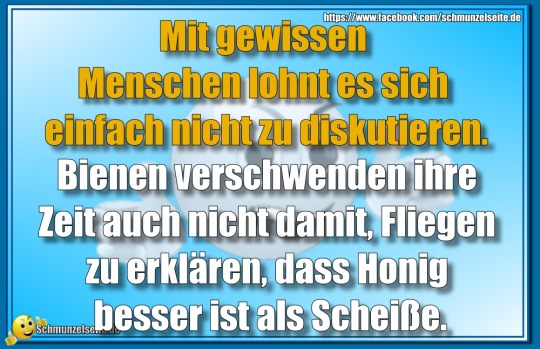
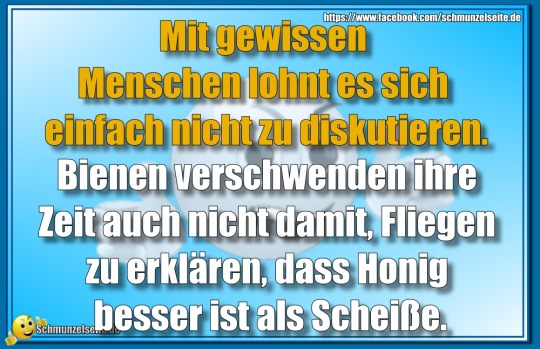
Mit gewissen Menschen lohnt es sich einfach nicht zu diskutieren.
Bienen verschwenden ihre Zeit auch nicht damit, Fliegen zu erklären, dass Honig besser ist als Scheiße.
Read the full article
0 notes
Text
sundaysforlife
sundaysforlife: #Embryonen sind keine potenziellen Menschen, sie sind Menschen. Du kannst diese #Tatsache nicht ändern, nur um dein #Gewissen zu beruhigen. https://t.co/VAMm6LEiLn
https://twitter.com/sundaysforlife/status/1581299017899601920
0 notes
Text
29.12.14
[Durchgestrichen] So, als erstes: ich hatte gerade ein Gespräch mit meiner Mutter, ‚weil ich ja immer schweigen muss‘ -.- Und ehrlich gesagt: Obwohl ich meine Worte alle gut ausgedrückt habe und ihr meine Gefühle/ Denkweisen herüber gebracht habe, fühle ich mich trotzdem nicht besser. Im Gegengeil. Es ist ein Kreislauf und das Ziel dessen ist Enttäuschung meinerseits von anderen Personen (andere = enttäuscht von mir).
Und ich glaube, ich hasse das einfach, wenn jemand weiß, wie ich fühle. Denn meine Mutti verwendet es im nächsten Streit wieder gegen mich. Klar, ich warte auf so eine Person, die mich versteht und mich kennt – die wird es vllt auch geben! Doch niemand, wirklich niemand wird diese Lasten auf sich tragen können… ich tue Menschen nur damit weh und enttäusche sie. Sag ich doch, egal was, das Ziel ist Enttäuschung. 1. Weg = Klappe aufmachen, 2. Weg = Klappe aufmachen, 1. Weg = selbst schuld geben, 2. Weg = schuld bekommen, 1. Weg und 2. Weg = von anderen nieder gemacht werden, also kommt’s auf’s Selbe hinaus.
Ich weiß es nicht und niemand würde sich dafür interessieren. Aber egal – so ist die Gesellschaft, oder mein Familienhaus? Ich bin eben ein guter Pessimist und kann nichts, ich muss immer alles verhauen. Entweder ich bin ein Versager beim Sport, in der Schule, bei Freundschaften/ der Liebe, oder ich enttäusche Leute und kann niemand an mich heran lassen. Das bin ich - passt genau. Was solls, warum Gedanken und Zeit verschwenden, wenn es sowieso niemanden interessiert und man irgendwann stirbt. Eigentlich tue ich das alles hier auch nur für das Papier, aber wirklich befreiender ist es auch nicht. Was soll’s. Ich habe iwie ein schlechtes Gewissen. Mam weiß jetzt, wie ich ticke – und ich hasse dieses Gefühl. Ich möchte nicht, dass sich Sorgen um mich gemacht werden, dass jemand an mich denkt, oder dass jemand sämtliche Emotionen wegen mir verspürt. Ich hasse es. Ich muss ihr das morgen unbedingt aus dem Kopf ausreden. Ich hasse es. Spruch Mam: „Ich habe Angst, dass du später einmal alleine sein wirst“
0 notes
Text

Letztens beim rewatch ja wieder gefragt, warum man erst das Benzin um Roland rum kippt und den dann da durch zieht. Aber…
Adam hatte einfach erst nen anderen Plan? Und hat sich dann umentschieden??
#wollte Adam das wirklich machen#und hat dann n schlechtes Gewissen gekriegt#Oder Angst wegen Leo?#tatort saarbrücken#spatort#adam schürk#leo hölzer
87 notes
·
View notes