#naturgesetz
Text

leipzig 2023
27 notes
·
View notes
Photo

Die Preise
A3 Risoprint
get it here:
https://sternstundendeskapitalismus.de/produkt/die-preise/
oder im guten, alten nachladen.
sternstrasse 17, HH
#immernochbilligeralsnächstewoche#tendenenziellerfallderprofitrate#sternstundendeskapitalismus#naturgesetz#diepreisesteigen#nicht#siewerdenerhöht
10 notes
·
View notes
Text

Austausch mit dem Physiker
Zur epistimologischen Genese der Naturgesetze. Die Anwendung juristischer Prinzipien auf die Beschreibung der Natur. Die abendländische Wissenschaft als Ergebnis der Übernahme des römischen Zivilrechts durch das Christentum. Die päpstliche Theokratie habe eine machtpolitisch effektive Verschmelzung juridischer Operatoren mit den christlichen Texten vollzogen (Legendre). Idee und Begriff des Gesetzes werden als Rationalitätstypus ubiquitär. Entgegnung: der Islam und die Wissenschaften, Abu Ishaq Ibrahim ibn Yahya an-Naqqasch az-Zarqali, der arabische Mathematiker aus Toledo, der herausragendste Astronom seiner Zeit.
0 notes
Text
Warum die radikale-Linke untergehen wird...
Warum die radikale-Linke untergehen wird…
(more…)

View On WordPress
#Die Ampel baut auf Abstraktionen und Emotionen#Grüne Sozialisten#linker Radikalismus#Links-Grüne Abschaffung der Naturgesetze#Untergang der Woke-Kultur
0 notes
Text
Alles verändert sich - immer und zu jeder Zeit. Je früher wir das lernen, desto eher verstehen wir die Naturgesetze des Lebens und können loslassen, woran wir stetig anhaften.
× Shunyatah | Gedanken.
#gedanken#anhaften#loslassen#leere#gefühle#zitate#tagebuch#basis noir soninja#angst#essstörung#liebe#tränen#leben#quote
30 notes
·
View notes
Text
„In den sozialen Medien leben wir noch in einer wilden Zeit, die das alles noch nicht hat.“ Auch deshalb würden diese erwiesenermaßen zur Polarisierung beitragen, Echokammern und Blasen hervorbringen. Renn plädiert dafür, das Potenzial der sozialen Medien „noch mal ganz anders zu nutzen“. Die Gesellschaft müsse die neuen Medien so gestalten, dass das, „was wir verbindlich wissen, eine größere Rolle spielen kann“. Denn dass Facebook, Twitter, Instagram oder TikTok so sind, wie sie sind, sei kein Naturgesetz. „Das ist so gemacht, und dahinter stecken ökonomische Interessen.“
Das gelte es zu ändern – und so zu organisieren, dass Wissen eine viel zentralere Rolle spiele. Renn denkt etwa an ein öffentlich-rechtliches Internet. „Europa könnte viel mehr machen, um sicherzustellen, dass unsere demokratischen Gesellschaften auch über das geteilte Wissen verfügen, das sie zum Handeln in dieser komplexen Situation brauchen.“
Eine solche Netz- und Medieninfrastruktur, demokratisch kontrolliert, dem Renditezwang entzogen und dafür dem Kampf gegen Fake News verpflichtet, könnte ein Ort sein, an dem es leichter wird zu erfahren, was ist – dies ist heute erschreckend genug. Mit der Zumutung der Wirklichkeit muss man leben. Mit einem wettbewerbsgetriebenen Alarmismus, der sich verschärfende Krisen noch weiter anspitzt, und Social-Media-Echokammern, die Fatalismus zementieren, nicht.
omg stellt euch vor
10 notes
·
View notes
Text
Rede I.K.H. Kronprinzessin Victoria von Schweden am Volkstrauertag
Berlin, Deutschland
Herr Bundespräsident, Frau Vize Bundestagspräsidentin,
verehrte Mitglieder des Deutschen Bundestags, meine Damen und Herren,
Herr Bundespräsident, Frau Vize Bundestagspräsidentin, Herr Bundeskanzler,
verehrte Mitglieder des Deutschen Bundestags, meine Damen und Herren,
es ist mir eine große Ehre, diesen deutschen Gedenktag für die Opfer von Gewalt und Krieg mit Ihnen begehen zu dürfen.
Man kann sich kaum einen würdigeren Ort vorstellen, sich zu versammeln als hier. Dieses Gebäude hat in der dramatischen Geschichte Deutschlands eine so wichtige Rolle gespielt. Heute symbolisiert es das moderne und demokratische Deutschland.
Für mich persönlich ist dies ein wichtiger Augenblick. Meine starken familiären Bindungen zu Deutschland und alles Deutsche sind seit meiner Kindheit feste Bestandteile meines Lebens. Meine Gefühle für Deutschland sind innig und tief.
Auch für mich als Kronprinzessin und Repräsentantin des Königreichs Schweden ist dies ein bedeutender Moment.
Die Beziehungen zwischen meinem Land und Deutschland sind vielfältig, stark und reichen weit in die Geschichte zurück.
Gleichwohl waren sie in der Geschichte nicht immer friedlicher Natur. Daran sollten wir uns mit Demut erinnern, besonders an einem Tag wie diesem.
Vielleicht kennen einige von Ihnen noch das alte Kinderlied „Bet't Kinder, bet't / Morgen kommt der Schwed“ aus dem Dreißigjährigen Krieg. Als Schwedin ist mir bewusst, dass dieser Krieg lange als deutsche Ur-Katastrophe betrachtet wurde.
Im Jahr 1813 standen schwedische Truppen noch einmal auf deutschem Boden. Mein Vorfahr, Kronprinz Karl Johan, führte die Nordarmee aus Preußen, Russen und Schweden gegen das große Heer von Kaiser Napoleon an. Und obwohl Schweden zu den Siegern zählte, war die Zeit als Großmacht vorbei. Ganz bewusst wurde in Schweden der Grundstein für eine historische Zeitenwende gelegt.
Was wir an Macht und Ruhm verloren, gewannen wir in Form von mehr als zweihundert Jahren Frieden und schließlich unseres eigenen Wirtschaftswunders zurück.
Mein Land ist von Natur aus eng mit Deutschland verbunden. Seit fast eintausend Jahren gibt es starke kulturelle, sprachliche und wirtschaftliche Verbindungen über die Ostsee hinweg. Wir wurden gemeinsam von der Hanse, der Reformation und der Industrialisierung geprägt.
Der Zweite Weltkrieg veranlasste Schweden, sich von einem Großteil seines deutschen Erbes zu distanzieren. Doch seit die demokratische und wiedervereinte Bundesrepublik zu einem Stabilitätsanker für die Europäische Union geworden ist und Schweden Mitglied der EU ist, sind wieder enge Beziehungen zwischen unseren Ländern entstanden. Und heute sind wir zu unserem Glück vereint.
Hieraus können wir wichtige Lehren ziehen: Wie Länder und Völker in der Nähe zueinander und an dieser Nähe wachsen können. Wie wichtig der freie Fluss von Kultur und Ideen ist. Und wie viel auch plötzlich verloren gehen kann.
Meine Damen und Herren,
kaum jemand weiß mehr über die Zerbrechlichkeit einer Zivilisation als das deutsche Volk.
Kaum jemand kennt den Unterschied zwischen Frieden und Krieg, zwischen Freiheit und Unterdrückung, zwischen Hoffnung und Abgrund, zwischen Normalität und Katastrophe besser. Aber auch ich habe dies nicht nur aus Büchern gelernt. Indem ich meiner Mutter und den Erzählungen über das Schicksal ihrer Familie zuhörte, bekam ich zumindest einen Bruchteil dieser bitteren Erfahrung vermittelt.
Die deutsche Erfahrung mag einzigartig sein, enthält aber Erkenntnisse, die weit über sie hinausreichen. Eine davon ist, dass Frieden und Freiheit keine Naturgesetze sind, ein für alle Mal gegeben. Sie sind ein Gut, das zerbrechlicher ist, als wir denken, und für das sich jeder von uns einsetzen muss; im Großen wie im Kleinen. Wir tun dies jeden Tag, indem wir Rücksicht nehmen und Respekt zeigen; als Staaten, indem wir unsere demokratischen Gesellschaftsordnungen und das Prinzip verteidigen, dass Recht vor Macht geht.
Ich sage das mit großem Ernst, denn wir versammeln uns hier in ernsten Zeiten.
Meine Damen und Herren,
Die Menschheit steht vor Herausforderungen, die immer schwieriger und dringlicher werden. Die Stimmung in der Welt ist so eisig wie seit langem nicht mehr. Die groß angelegte russische Invasion in der Ukraine bedroht den Frieden auf unserem
gesamten Kontinent, erschüttert die Grundfesten der Weltordnung und verursacht unermessliches menschliches Leid. Seit 633 Tagen werden Städte und Gemeinden zerstört, Hunderttausende Menschen getötet und Millionen vertrieben. Es ist ein Krieg, der uns an die dunkelsten Kapitel der europäischen Geschichte erinnert.
Hinzu kommen die Entwicklungen im Nahen Osten nach den schrecklichen Angriffen der Hamas auf israelische Zivilisten. Wir sehen entsetzliche Bilder aus Gaza mit großem menschlichen Leid. Natürlich hat auch Israel das Recht, sich in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht zu verteidigen. Der Schutz aller Zivilisten, sowohl in Israel als auch in Gaza, muss garantiert und das humanitäre Völkerrecht respektiert werden. Zu jeder Zeit, unter allen Umständen.
Werte Mitglieder des Deutschen Bundestags, meine Damen und Herren,
meine Generation ist mit dem Fall der Mauer aufgewachsen. Ich wünschte, der Optimismus, der damals alle erfüllte, könnte die Welt auch weiterhin prägen.
Es gibt ein Wort, dessen Bedeutung ich am anschaulichsten von meinem Vater gelernt habe: Pflicht. Aber die Pflicht hat auch eine schöne Seite. Sie gibt uns die Möglichkeit, Teil von etwas zu werden, das viel größer ist als wir selbst.
Der Schwede Dag Hammarskjöld, ehemaliger Generalsekretär der Vereinten Nationen, schrieb einst folgende Zeilen: „Der Weg der anderen hat Rastplätze in der Sonne, wo sie sich treffen / Aber dies ist dein Weg / und jetzt, jetzt darfst du nicht scheitern. / Weine, wenn du kannst, weine, / aber klage nicht. / Der Weg hat dich gewählt – und du solltest dankbar sein.“
Meine Damen und Herren,
Wir müssen gemeinsam Verantwortung übernehmen. Wir dürfen niemals die Lehren aus den Schrecken von Krieg und Tyrannei vergessen. Und es ist wichtig, unsere Kinder und Jugendlichen daran zu erinnern, dass aus den schwierigsten Erfahrungen eine Kraft zur Veränderung erwachsen kann.
Dies ist eine Zeit wichtiger Entscheidungen. Eine Zeit der Prüfungen. Aber auch eine Zeit der Chancen.
Da unsere Völker und Regierungen gemeinsam handeln, um dem ukrainischen Volk zu helfen, sich gegen die russische Aggression zu wehren, bin ich überzeugt, dass unsere Bemühungen Früchte tragen werden.
Es ist eine Quelle der Hoffnung, dass die Regierungen und Völker im demokratischen Europa in einer schweren Zeit zusammenhalten.
Die deutsche Erfahrung zeigt, dass es möglich ist, selbst die dunkelste Vergangenheit zu überwinden.
Heute ist Deutschland ein Land, auf das wir Schweden blicken, wenn es um die gemeinsame Aufgabe geht, ein Europa des Friedens und der Freiheit zu errichten.
Unsere Länder sind in einer Wertegemeinschaft vereint, in unserem Verständnis von Freiheit, Demokratie und Menschenrechten, in unserem europäischen und internationalen Engagement. Und wir stehen heute noch enger zusammen als früher. Seit Februar 2022 benutzt die Welt das Wort ‚Zeitenwende‘. Auch Schweden erlebt gerade eine solche Zeitenwende und mit seinem Beitritt zur NATO die größte sicherheitspolitische Veränderung seit den Napoleonischen Kriegen.
Europa kommt jetzt zusammen, um sich den Herausforderungen zu stellen, vor denen unser Kontinent steht. Gleichzeitig müssen die großen Fragen der Zukunft angegangen werden wie Umwelt- und Klimaschutz sowie Möglichkeiten und Risiken neuer Technologien. Dies wird außergewöhnliche Anstrengungen erfordern.
Aber ich bin überzeugt, dass diese Anstrengungen unternommen werden und dass die schwedisch-deutsche Zusammenarbeit in dieser neuen Ära noch weiter ausgebaut wird.
Lassen Sie uns gemeinsam dazu beitragen!
Danke.
5 notes
·
View notes
Text
Auszüge aus dem Tagebuch des Tadeusz Broz'; 1708-1731; Gdańsk
16. April 1708
Nun sind es schon drei Wochen, seit unsere kleine Ewa das Zeitliche gesegnet hat. Die Stille und Leere im Haus sind unerträglich. Doch was mich am meisten beunruhigt, das ist der Zustand meiner lieben Radomila. Der Verlust scheint sie noch stärker mitzunehmen als mich. Ich vermag mir ihr Leid gar nicht vorzustellen und vielleicht ist es auch gut, dass mich die Trauer nicht derart lähmt. Ihre Apathie ist nicht zu ertragen. Nicht einmal ein Aufenthalt an der Ostsee konnte ihre Laune heben, dabei waren Ewa und sie mal verrückt nach diesem Anblick gewesen.
Ich weiß nicht, wie ich ihr helfen soll. Ob ich ihr überhaupt helfen kann. So Gott will, wird sie von dieser Trauer genesen.
04. Mai 1708
Ein sonderbarer Tag, anders kann ich es nicht beschreiben. Ich bekam unverhofft Besuch. Offensichtlich eilt mir der Ruf meiner alchemistischen Forschung voraus. Dabei habe ich diese schon vor Jahren eingestellt. Doch ein junger Herr, er stellte sich mir als Dryden Johnstone vor, muss während seines Studiums meine Abhandlungen in die Finger bekommen haben. Ich kann kaum glauben, dass meine Arbeiten es auf den Stundenplan der großen alchemistischen Akademien geschafft haben. Johnstone entpuppte sich als großer Bewunderer ebenjener. Als die Nachricht um den Tod Ewas die Runde machte, kam er nicht umhin, mich aufzusuchen - was ihm offensichtlich unangenehm war. Zugegeben, er hat sich nicht den besten Zeitpunkt ausgewählt, um mit mir Bekanntschaft zu machen, aber in diesen Zeiten ist es eine willkommene Ablenkung. Stundenlang haben wir uns über die Alchemie unterhalten und er unterbreitete das Angebot, mit ihm zusammen meine Forschungen wieder aufzunehmen. Mir gefällt sein Enthusiasmus - frisch aus der Ausbildung. Seine Begeisterung und sein Tatendrang erinnern mich an mich selbst, als ich in diesem jungen Alter war. Ich kann gar nicht sagen, wann ich diese erfrischende und aufregende Vernarrtheit in die Alchemie verloren habe. Johnstones Anerkennung, ja ich möchte fast sagen schiere Bewunderung, schmeichelt mir sehr. Dennoch habe ich um Bedenkzeit gebeten zwecks des Angebots. Im Moment ist mir nicht wohl dabei.
30. Mai 1708
Zu meiner großen Freude hat Johnstone Wort gehalten und ist zu unseren weiteren Unterredung erschienen. Sein Eifer ist ungebrochen, weshalb es mir umso mehr Freude bereitet hat, ihm zuzusagen. Wir werden mein Theorem neu aufgreifen und, so Gott will, vollenden. Johnstone ist ein kluger Mann und hat sein Studium erst frisch beendet - durch ihn können wir die aktuellsten Errungenschaften der Alchemie für uns nutzen, während ich meinen langen Erfahrungsschatz mit einbringen kann. Seit Ewas Tod habe ich mich nicht mehr so leicht gefühlt. Und nun bin ich voller Tatendrang und Zuversicht, dass wir es schaffen können. Für Ewa. Für Radomila. Für ein neues Zeitalter der Alchemie. Und natürlich auch für mich, sollte ich mein kleines Mädchen wirklich bald wieder im Arm halten können.
02. Juli 1708
Meine Liebe zur Alchemie ist neu entfacht. Mir ist, als wäre ich wieder Student. Ich habe vergessen, wie viel Lebensenergie einem eine Leidenschaft gibt und wir machen stetig Fortschritte. Die Formeln nehmen Gestalt an.
26. Februar 1711
Es ist vollbracht. Mir fehlen die Worte. All die Jahre schien es mir unmöglich, diese Formel zu vollenden. Die Lösung zu einer der größten alchemistischen Fragen, die es je gab. Wir haben die Welt revolutioniert. Nicht nur die der Alchemie. Die Naturgesetze wurden neu definiert. Es ist, als würde ich in das Antlitz Gottes blicken, ihm ebenbürtig sein. Und doch danke ich Gott, dass er uns diese Fähigkeiten mitgegeben hat. Ich werde ihm ewig dankbar sein, dass er ausgerechnet uns dazu befähigt hat. Dass er uns auserwählt hat. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass er mir die Chance gab, Ewa zurückzuholen. Ich werde sie hüten, wie meinen eigenen Augapfel.
11. Mai 1711
Etwas liegt im Argen. Erst glaubten wir, sie bräuchte nur ein wenig Eingewöhnung, aber ihr Zustand verbessert sich nicht. Sie ist immer noch so blass und schmächtig, wie am Anfang. Egal, wie sehr wir uns auch bemühen, das deftige Essen zeigt keine Wirkung. Wenn es nur dabei geblieben wäre ... Heute hatte sie einen Anfall. Uns ist es unerklärlich, was ihr fehlt. Es müssen ungeheure Schmerzen gewesen sein, doch sie hat den Zwischenfall gut überstanden. Radomila und ich beten für ihr Wohlergehen.
07. Januar 1712
Ewas Zustand verschlechtert sich zunehmend. Die Anfälle treten immer öfter auf und es bereitet mir so viel Leid, sie so zu sehen. Inzwischen haben wir schon mehrere Ärzte nach Rat gefragt, doch niemand kann uns helfen. Allem Anschein nach hat es mit dem Herzen zu tun.
03. September 1712
Da die Anfälle nicht abreißen, habe ich mich wieder in die Forschungsunterlagen geflüchtet. Ich kann nicht ausschließen, dass Johnstone und ich einen Fehler gemacht haben. Also überprüfe ich unsere Mitschriften. Im besten Fall kann ich den Fehler beheben. Inzwischen werde ich Johnstone einen Brief schreiben. Vier Augen sehen mehr als zwei.
19. November 1712
Meine Welt liegt in Trümmern. Ewa ging vor einer Woche von uns. Zum zweiten Mal. Die Ärzte haben sie postmortem untersucht - sie erzählten mir von einem völlig vernarbten Herz. Für Radomila war der erneute Verlust so unerträglich, dass sie ihr folgte. Ich kann den Schmerz nicht mehr ertragen. Und diese Schuldgefühle. Ich habe sie beide auf dem Gewissen. Wären ich und meine Eitelkeit nicht gewesen, hätte ich wenigstens noch Radomila an meiner Seite. Wir hätten diesen Schicksalsschlag gemeinsam überwinden können. Stattdessen war ich geblendet von meinem Können. Und von Johnstone ... Von ihm fehlt seit unserem Erfolg jede Spur. Wobei ich schon längst nicht mehr von Erfolg sprechen würde. Ich habe den Tod herausgefordert und Gott beleidigt. Sie haben mich auf meinen Platz verwiesen mit der schlimmsten Strafe, die einem Vater und Ehemann ereilen kann.
08. Dezember 1712
Ich habe Johnstone ausfindig machen können und ihn zur Rede gestellt. Kurz nach dem Verlust von Ewa und Radomila, habe ich mehrere Ungereimtheiten in den Formeln gefunden, die Johnstone und ich aufgestellt haben. Da ich sie zu Papier gebracht habe, konnte ich mich grob erinnern. Immer öfter entdeckte ich Symbole, die ich dort sicherlich nie platziert hatte. Sie ergaben keinen Sinn in Bezug auf meine Forschung. Erst glaubte ich, es wäre mein Verschulden. Dass meine Euphorie meine Genauigkeit beeinträchtigt hat. Doch die Unstimmigkeiten nahmen gewisse Muster an. Die falschen Symbole waren nicht zufällig dort gelandet. Es handelte sich eindeutig um Manipulation. Johnstone stritt meine Vermutung nicht ab. Im Gegenteil. Er schien stolz darauf zu sein. Von dem einst demütigen Studenten war nichts mehr übrig. Wenn ich ehrlich bin, war es, als würde ich in die hässliche Fratze des Teufels blicken. Zu allem Überfluss habe ich diesem Teufel auch noch eine Seele verkauft - nicht einmal meine eigene.
27. Dezember 1712
Ich habe von einem Kind gehört, ein paar Dörfer weiter, das Ewas rätselhafte Krankheit ebenfalls erleidet. Ich komme nicht umhin zu glauben, dass es kein Zufall ist. Also ging ich los, um der Familie einen Besuch abzustatten, mit Verweis darauf, was Ewa passiert war. Sie ließen mich zu ihrem Jungen. Er war erst einen Monat alt - sein Geburtsdatum entspricht dem Todestag Ewas.
Meine liebe Ewa, ich denke, ich habe dich gefunden. Welch ein Glück, dass deine ungebundene Seele nicht weit kam. So habe ich die Möglichkeit, dich bald zu mir zu holen.
15. Juni 1714
Es ist nun das dritte Mal, dass Ewa starb, wenn auch in Gestalt des kleinen Milosz. Ich ertrage das nicht mehr.
13. August 1714
Ich habe das neue Heim Ewas gefunden. Dieses Mal dauerte es noch länger, als das letzte Mal. Sie hat sich noch weiter von mir entfernt. Morgen werde ich meine Reise nach Berlin antreten. Dort ist sie jetzt. Diesmal unter dem Namen Martha. Ich kann es kaum erwarten, sie wieder bei mir zu haben. Ich bete dafür, dass uns diesmal mehr Zeit bleibt.
16. Oktober 1730
Ich weiß nicht, wie oft ich Ewa noch zu mir holen kann. Der Wechsel ihrer Wiedergeburten wird immer unberechenbarer und die Reisen verlangen mir viel ab. Ganz zu schweigen von den Recherchen, sie überhaupt ausfindig zu machen. Wären sie mir nur nicht auf die Schliche gekommen. In Gdańsk wird es allmählich ungemütlich für mich. Die Leute reden von Dingen, die sie nicht verstehen und doch kann ich es ihnen nicht verübeln. Es wird Zeit, unterzutauchen. Die Gerüchte haben inzwischen sogar schon alle Großen der Alchemie erreicht. Sie haben mir mein Opus Magnum und Minor bereits aberkannt und ich hörte davon, dass meine Lehren auf die schwarze Liste kommen. Die ersten Akademien und Bibliotheken verbrennen meine Werke. Ich werde mir etwas überlegen müssen, um wenigstens eine Abschrift für spätere Zeiten aufzubewahren. Für den Fall, dass jemand wirklich willens ist zu erfahren, was sich hier wirklich zutrug.
31. März 1731
Meine liebe Ewa,
dies ist, wie mir scheint, das Ende. Jedenfalls für mich. Ich wurde zum Tode verurteilt. Das Urteil überrascht mich nicht - ich könnte die Wahrheit niemandem begreiflich machen, der kein Alchemist ist. Ich vermute, selbst der Großteil der Alchemisten würde mir nicht glauben.
Es tut mir leid, was ich dir angetan habe. Ich hätte nicht versuchen dürfen, diese gottgewollte Grenze zu überschreiten. Doch glaube mir, ich tat es nicht, um dir zu schaden oder mich zu profilieren. Wenn überhaupt, dann tat ich es für Radomila, deine liebe Mutter. Sie war so unglücklich ohne dich und es bricht mir das Herz, dass ich euer Wiedersehen im Jenseits vereitelt habe.
Von nun an bist du auf dich allein gestellt. Glaube mir, wenn ich sage, dass ich jeden Tag versucht habe, meinen Fehler zu berichtigen und ich bedaure es, dass mir nun keine Zeit mehr bleibt und dass ich dich in dieser Welt zurücklassen muss. Ich hoffe, dass wir uns eines Tages auf der anderen Seite wiedersehen.
Dein dich liebender Vater,
Tadeusz Broz
4 notes
·
View notes
Text
Gerade habe ich den Impuls, das....
ich dich gern mitnehmen möchte auf meine Gedanken und Eingebungen und was weiß ich auch "fern" von uns ... einfach weil ich weiß, du machst was tolles draus.
Und selbst wenn nicht, würde ich es mit keinem lieber in "Bewegung" setzen(:
Also ... (:
Ich bin nicht meine Gedanken, Gefühle und nicht mein Koerper.
Doch wenn ich das alles nicht bin, was ich nicht bin und dahinter eine Wahrnehmung von etwas ist, was immer alles mitbekommt und weiterhin glaubt alles zu sein und grenzenlos zu sein, warum kann das mein Koerper nicht umsetzen.
Warum muss er dann schlafen, ist müde, hat Hunger oder zwackt?
Warum kann er dann nicht fliegen?
Warum hat er dann Symptom x oder y.
Die Stimme/ das Gefühl/ das Bewusstsein "sagt", daß bin ich alles nicht, ich bin viel mehr und ich bin grenzenlos.
Ich kann es auch fühlen, wie ich fliege, dein Körperzwacken habe und keinen Schlaf brauche. Ich kann meinen Körper sogar schlafen lassen und ich bin wach ... doch mein Körper braucht den Schlaf immer noch, warum?
Was hält meinen Körper davon ab, das umzusetzen, was eine tiefe innere Wahrheit/Weisheit ist... ja schon fast ein Naturgesetz?
Jetzt sag nicht die Naturgesetze des Körpers :D
So ein Kleinhalten der eigenen Größe...
Naja und vielleicht ist ja auch egal warum...
Die Frage ist, wie kann diese Wahrheit auch mein Körper fühlen, erleben, umsetzen, erfahren, leben?
4 notes
·
View notes
Text
Maria Stepanova/ FAZ
Die russische Frage
Mitte März letzten Jahres waren auf dem Moskauer Flughafen Wnukowo so gut wie alle Abfertigungsschalter geschlossen, nur an einem lief der Check-in für einen Flug nach Istanbul. Die Schlange war lang. Während wir warteten, zählte ich die Tiertransportboxen: Hunde, Katzen, mehrere Vögel – die Leute planten nicht, bald zurückzukommen. Nach der Passkontrolle fand ich eine Raucherkabine. Sie war schmal und eng wie eine Hundehütte. Drinnen stand schon ein Mann. Er gab mir Feuer und fragte: „Und von wo flüchten Sie?“
Er selbst flüchtete aus Donezk, im Moment versuchte er, sich via Moskau nach England durchzuschlagen, zu seinem Sohn. „Wir haben euch ganz schön eingeheizt“, sagte er auf Russisch zu mir. „Wir machen euch fertig, ihr werdet schon sehen.“
Ich meinerseits hatte nicht das Gefühl, auf der Flucht zu sein, eher im freien Fall – ich bewegte mich durch einen Raum, in dem ich plötzlich keinen Boden mehr unter den Füßen spürte. Für meine Reise gab es Gründe, langfristige Pläne, und diese Pläne wurden weiterhin umgesetzt, obwohl die Naturgesetze teils aufgehoben waren. Der von Russland begonnene Krieg hatte die alten Zusammenhänge obsolet gemacht: Alles, was außerhalb der Ukraine geschah, hatte keinen Zweck, keinen Sinn und kein Gewicht mehr – der Schwerpunkt hatte sich verschoben, er lag jetzt dort, wo Charkiw und Kiew beschossen wurden; wir dagegen setzten abseits davon aus reiner Trägheit irgendwelche unklaren Bewegungen fort, als wäre die Welt nicht zusammengebrochen. Doch es war nichts mehr wie zuvor. Die Leute schliefen nicht mehr, auf den Displays leuchteten spät nachts wie frühmorgens die grünen Chatfenster, und Informationen – Schlagzeilen, Telegram-Nachrichten, Namen von Städten und Dörfern, Opferzahlen – konnte man neuerdings rund um die Uhr austauschen, weil sowieso niemand etwas anderes tat. Wenn man von Putin sprach, sagte man nur er, ohne weitere Erläuterung, und alle wussten, von wem die Rede war, wie in den Harry-Potter-Büchern, wo Lord Voldemort nicht beim Namen genannt werden darf.
„Wir“ waren zum Ort des Todes geworden
Auf Facebook erzählten die Leute davon, wie sie in den ersten paar Minuten nach dem Aufwachen regelmäßig vergessen hatten, was geschehen war, und erst dann brach es über sie herein; sie erzählten, dass sie nicht schlafen konnten; sie schrieben wie immer – Kommentare über sich, über das, was ihnen passierte, im kleinen Radius ihres eigenen Lebens, nur dass dieses Leben mit Beginn des Krieges über Nacht seinen Wert verloren hatte: Es ging weiter, aber es bedeutete nichts mehr, und auch das Schreiben war sinnlos geworden. Selbstwertgefühl, Selbstachtung, der natürliche Glaube an das eigene Recht, sich zu äußern und gehört zu werden, dieses ganze vertraute Denkbiotop war plötzlich verwelkt und vertrocknet, abgestorben. Mein Land hatte Tod und Leid über ein anderes Land gebracht, und seither war die Ukraine, die ihre Alten, ihre Kinder, ihre Hunde zu schützen suchte, der einzige verbliebene Ort des Lebens – ein Ort, wo man für das Leben kämpfte, Leben rettete. „Wir“ dagegen waren zum Ort des Todes geworden, ein Ort, von dem der Tod sich ausbreitete wie eine Seuche, und dieser Gedanke war ungewohnt.
Denn dieselben wir – Menschen meiner Generation und älter – waren einst in einem Land groß geworden, dessen zentrales Narrativ, das alle Bewohner vereinte, nicht etwa der Traum vom Aufbau des Kommunismus war, sondern das Wissen um unseren Sieg in einem furchtbaren Krieg und die Überzeugung, dass es nichts Wichtigeres gab, als keinen weiteren Krieg zuzulassen. In diesem wir bündelte sich wie in einem Prisma die Erinnerung an unermessliches Leid und an eine ebenso unermessliche Anstrengung, die nötig gewesen war, um zu siegen; es war in gewissem Sinn gar nicht denkbar ohne die Erinnerung an das gemeinsam erbrachte Opfer, das alle verband. Der Sieg im Zweiten Weltkrieg war wohl das einzige historische Faktum, über das in Putins Russland Einigkeit herrschte. Alles andere und alle anderen – Iwan der Schreckliche und Stalin, Peter der Große und Lenin, die Revolution von 1917 und der Zerfall der Sowjetunion, der Große Terror der 1930er- und die Reformen der 1990er-Jahre – waren und sind bis heute umstritten, und der Streit darüber wird im Lauf der Zeit immer hitziger, eine Art Erinnerungsbürgerkrieg, ein Bruderkrieg, in dem niemand mit niemandem übereinstimmt.
Ein ohnmächtiger Teil der Gewalt
Dieses Fehlen einer gemeinsamen Erinnerung, eines gemeinsamen, von der Mehrheit der Gesellschaft geteilten Blicks auf die eigene Geschichte ist einer der charakteristischsten und konstantesten Züge der russländischen Wirklichkeit. Allein der Zweite Weltkrieg – der Sieg ebenso wie die unheilbare Wunde, die dieser Krieg dem lebendigen Körper des Landes zugefügt hat, und die besondere, sakrale Bedeutung dieses Kriegs und Siegs – bleibt ein Feld, auf dem Geschichte eine von allen gemeinsam durchlebte Erfahrung ist, an der jeder seinen Anteil hat.
Dass das so ist, hat mit dem so seltenen wie kostbaren Gefühl zu tun, dass das Leid und der gewaltsame Tod von Millionen wenigstens in diesem Abschnitt der russländischen Geschichte einen Sinn hatten, dass sie nicht nur ein unbegreiflicher, grundloser Zufall waren, ein Opfer für die geheimnisvollen Götter der Revolution und des Imperiums: Sie waren nötig, um uns, ja die ganze Welt vor dem ultimativen Bösen zu retten. Wir damals, die kurz zuvor noch Täter und Opfer gewesen waren, standen plötzlich für das Gute, waren Sieger in seinem Namen. Wir waren überfallen worden. Wir hatten uns verteidigt. Ohne uns hätte es diesen Sieg nicht gegeben. Das genügte, um für sehr lange Zeit von der eigenen Gutartigkeit überzeugt zu bleiben.
Doch wenn der damalige Krieg den Knoten eines wie auch immer heterogenen „wir“ geschürzt hat, dann gilt dasselbe auch für den jetzigen – auf verheerend andere Weise: Wir verteidigen uns nicht, sondern überfallen, wir tun genau das, was damals uns angetan wurde – wir dringen in ein fremdes Land ein, wir bombardieren Schlafende, besetzen friedliche Städte und Dörfer. Wir sind heute genau jene Kräfte des Bösen, die wir aus den Schulbüchern und Heldenbiographien unserer Kindheit kennen, und diese Erkenntnis ist umso unerträglicher, als alle Differenzierungen in diesem Zusammenhang irrelevant sind. Die Gewalt dieser Monate geht von Russland aus, von seinem Staatsgebiet wird sie nach außen getragen – und wenn ich sie nicht stoppen kann, dann werde ich Teil von ihr, ein ohnmächtiger Teil dessen oder derer, die dafür verantwortlich sind.
Die Logik des Krieges verwischt die Details
Diejenigen, die auf Putins Seite stehen, und diejenigen, die ihn all die Jahre auf jede mögliche Weise bekämpft haben, lassen sich in dieser kompakten, bedrohlichen Dunkelheit nicht mehr auseinanderhalten. Der Unterschied zwischen Russland und den Russen, zwischen dem Land mit seinen Grenzen und physischen Umrissen und dem russländischen Staat, zwischen Menschen, die hier leben, und Menschen, die früher einmal hier gelebt haben, zwischen der russischen Sprache und ihren Sprechern, zwischen denen, die gegangen sind, und denen, die bleiben, ist unerheblich geworden. Noch vor Kurzem war er entscheidend, doch heute liegen die Dinge anders.
Dabei geht es gar nicht so sehr darum, wie die Außenwelt zu „den Russen“ steht, sondern darum, was uns selbst Angst macht und weshalb. „Wir“, die wir gegen, und „wir“, die wir für Putin sind, wollen auf keinen Fall die Bösen sein, und die Einsicht, dass wir uns dem nicht entziehen können, ist für beide Gruppen schwer erträglich. Die Logik des Krieges verwischt die Details, sie fordert Verallgemeinerung: Staatsbürgerschaft, Sprache, ethnische Zugehörigkeit verwandeln sich in eine Art Zement, der disparate Individuen zu einer Gemeinschaft zusammenbackt, und deren Konturen definieren sich nicht von innen, sondern von außen. Die persönliche Entscheidung, die Biographie des Einzelnen, die Feinheiten seiner politischen Position sind mit einem Mal irrelevant, reine Privatsache. Wir fürchten uns vor uns selbst, schrecken vor uns selbst zurück. Noch bevor man anfängt, uns zu hassen, hassen wir uns selbst.
Sieht man sich an, wie dieses „wir“ konstruiert wird, so zeigt sich schnell, dass es ufer- und grenzenlos ist. Wer versucht, es mit den üblichen Kriterien – der schon genannten Staatsangehörigkeit, der Sprache, des Wohnorts – einzugrenzen, erkennt, wie wenig diese Kategorien mit der gegenwärtigen Katastrophe zu tun haben. In den letzten Monaten habe ich mit Menschen gesprochen, die Russland verlassen haben (weil sie mit einem Land, das so etwas tut, nichts mehr zu tun haben wollen), und mit solchen, die sich entschieden haben zu bleiben (um von innen Widerstand gegen das Regime zu leisten, so gefährlich das auch ist, und weil man das Land, das man liebt, doch nicht seinen Mördern überlassen könne), mit Menschen, die schon vor zwanzig, dreißig, vierzig Jahren ausgewandert sind, und mit solchen, die in der Emigration geboren wurden, und sie alle nehmen einen Platz in dieser Konstellation ein, auch wenn sie bisweilen verzweifelt auf ihrer Nichtzugehörigkeit bestehen.
Eine gemeinsame Gewissheit
Das neue „Wir“ verbindet diejenigen, die sagen „das ist auch meine Schuld“, und diejenigen, die überzeugt sind, dass sie das alles nichts angeht, gleichermaßen. Es mag keine klaren Konturen haben, doch es enthält eine gemeinsame Gewissheit: Wir leben in einer neuen Realität, deren Wörterbuch erst noch geschrieben werden muss. Sie manifestiert sich als Gewalt gegen die einstmals bekannte Welt, gegen das gewohnte System von Beziehungen und Annahmen. Der Krieg hat all unsere früheren Gewissheiten über uns selbst niedergerissen und lässt in unserem zukünftigen Selbstverständnis, unserer Selbstbeschreibung keinen Stein auf dem anderen. Nach Butscha und Mariupol stecken unsere individuellen Geschichten in einem einzigen großen Sack, und man wird sie im selben Licht betrachten – „russländische Staatsbürger“ oder „Russen“, Russischsprachige oder Vertreter der russischen Kultur, (ehemalige) Einwohner Russlands oder nicht, wir gehören zur Gemeinschaft derer, die das getan haben – und eben darin müssen wir von nun an unseren Platz und seinen Sinn suchen.
Man kann annehmen, dass sich das nur einem Blick von außen so darstellt, während aus der Innensicht (der jedes einzelnen Bewusstseins, das sich unter den Bedingungen der eingetretenen Katastrophe neu zu definieren sucht) alles komplizierter ist. Doch letztlich ist gerade der Blick von außen – ein distanzierter Blick, der von unserer liebenswerten Subjektivität nichts wissen will – heute der einzige, der bleibt, und so schwer es fällt, sich daran zu gewöhnen: Es ist genau dieser Blick, mit dem wir uns auch selbst betrachten. Wir sehen uns im Spiegel und erkennen uns nicht: Bin der Kerl dort am Ende ich? Sah so Mamas Liebling aus?
Am seltsamsten ist, dass dieses Grauen vor dem distanzierten Blick, den man auf der eigenen Haut spürt wie ein Brandmal, sogar diejenigen befällt, die für den Krieg sind, die ihn als „Spezialoperation“ bezeichnen, als notwendigen Schritt zur Selbstverteidigung und dergleichen mehr. Vor Kurzem saß ich im Flugzeug und hörte eine Unterhaltung mit, die in der Sitzreihe neben mir geführt wurde – auf Russisch. „Kreditkarten funktionieren ja nicht mehr“, sagte eine elegante Frau in Schwarz zu meiner Nachbarin. Und dann, mit tief empfundenem, hasserfülltem Nachdruck: „Wegen dieser Kanaillen.“ Mir ging durch den Sinn, dass mit „Kanaillen“ in diesem Fall ohne Weiteres beide Seiten gemeint sein konnten – Putin mit seinem Staatsapparat ebenso wie die internationale Staatengemeinschaft mit ihren Sanktionen oder auch ich, die diese Sanktionen guthieß. Wer überrumpelt und aus einem Leben herausgerissen wird, das er als sein verlässliches Eigentum betrachtet hat (wie alle die, die am Morgen des 24. Februar in Kiew und Charkiw aufgewacht sind?
Sturz ins Nichts
Der Vergleich verbietet sich, dort werden nicht wir bombardiert, dort bombardieren wir), ist unmittelbar mit seiner eigenen Ohnmacht konfrontiert – und versucht daraufhin oft, sich von jeder Verantwortung freizusprechen. Nicht wir haben den Krieg angefangen, sondern Putin, wir haben damit nichts zu tun, denken manche von uns. Nicht wir sind schuld, sondern die westlichen Politiker, die NATO, die „Nazis“, der ukrainische Staat, der Kapitalismus, erklären andere. Zwischen so vielen echten und vermeintlichen Verantwortungsträgern fällt es immer schwerer, sich selbst zu sehen – wie in einem dieser Wimmelbilderbücher, wo es im dichten Laub oder in einem Berg von Spielzeug einen Vogel, einen Schmetterling, ein Schiffchen zu finden gilt.
Das eingangs erwähnte Gefühl des freien, zeitlich wie räumlich unbegrenzten Falls kennen auf die eine oder andere Weise alle, mit denen ich in diesen endlosen Monaten seit Februar gesprochen habe. Fallen – das Wort passt hier gerade in seiner Mehrdeutigkeit gut: Man kann es als Sturz ins Nichts verstehen, als Abweichung von der moralischen Norm, die die Gesellschaft zusammenhält, als Abfall von einem zivilisatorischen Konsens oder als Herausfallen aus dem Nest der menschlichen Gemeinschaft. Das Gefühl verbindet (ohne zwangsläufig Nähe zu erzeugen) alle, die diesen Krieg als Manifestation des Bösen sehen und sich selbst als stigmatisiert durch eine undefinierbare Verbindung zu diesem Bösen. „Being Russian“ nennt die Außenwelt das neuerdings kurz – aber für diejenigen, die durch Geburt, Wohnort, Sprache, familiäre Tradition, Liebe, Hass, transgenerationelle Erinnerung, manchmal auch nur durch ihren von den Großeltern übernommenen Familiennamen mit Russland verbunden sind, bleibt die Bindung namenlos. Sie tut einfach nur weh. Im Grunde ist es genau das: Dass man Schuld hat, erkennt man an einem unleugbaren, mit nichts zu verwechselnden Schmerz.
Keine Eigenschaft, sondern eine Existenzbedingung
Muss man – im Rückgriff auf Hannah Arendt und Simone Weil – entscheiden, ob es sich bei diesem Gefühl um Verantwortung oder Schuld handelt, muss man analysieren, in welchem Verhältnis das Individuelle und das Kollektive hier zueinander stehen? Es wird Jahre dauern, bis wir dazu in der Lage sind – Jahre nicht vom Beginn des Kriegs an gezählt, sondern von seinem Ende, das allem Anschein nach weit entfernt ist. Vielleicht wäre es an diesem Punkt sinnvoll, vorläufig nicht über Unterschiede und Differenzierungen nachzudenken, sondern darüber, was wir weiter tun können.
Es wirkt unpassend, von sich zu sprechen; ich versuche mich kurz zu fassen. Ich wurde 1972 geboren, vom Krieg trennten mich nur dreißig Jahre – dieselbe Frist, die auch zwischen dem, wie es seinerzeit hieß, weitgehend unblutigen Zerfall der Sowjetunion und Russlands Überfall auf die Ukraine liegt. Der Krieg war in meiner Kindheit überall: Selbst in den Schlafliedern, die meine Mutter mir sang, ging es um Kriegsschiffe auf Reede, um Schüsse und einen Toten im Steppengras. In unserer russisch-jüdischen Familie (in der die Juden die Mehrheit bildeten; russisch war nur mein Großvater, dessen Name – Stepanov – auf meinen Vater und auf uns überging) wurde vom Russischsein nicht geredet.
Ihr Jüdischsein dagegen vergaßen meine Eltern nie: Von ihm ging Gefahr aus, es verursachte Schmerz und weckte Liebe, es war enorm wichtig, obwohl mir schleierhaft war, worin es eigentlich bestand und inwiefern es uns von anderen Leuten unterschied. Von innen hatte ich nicht das Gefühl, anders zu sein – von außen war es anscheinend unübersehbar. Jüdischsein war keine Eigenschaft, sondern eine Existenzbedingung: In unserem Leben kam man nicht um sie herum. Wenn ich nach meiner Nationalität gefragt wurde, sagte ich „jüdisch“.
Zu diesem wir zu gehören ist qualvoll
Später wurde ich – zumal in der anglophonen Welt, wo derlei Präzisierungen unmittelbare Bedeutung fürs Marketing haben – gelegentlich gefragt, wie ich vorgestellt werden möchte: als russische, russisch-jüdische oder jüdische Autorin? Bislang antwortete ich darauf meist, dass mir das egal ist – und dachte im Stillen, dass ich mich weder als russische noch als jüdische Autorin fühle und noch weniger als Vertreterin der russländischen Literatur mit ihren Massenauflagen und Messeständen. Ich mochte die Vorstellung, dass ich für niemanden außer mir selbst spreche und ausschließlich für mich verantwortlich bin. Ich vergaß beinahe, was Leiden am Nationalen ist und wie es sich anfühlt; dann begann die Gewohnheit zu bröckeln, leise und unmerklich, und am 24. Februar brach sie ein für alle Mal ab. Heute antworte ich auf die Frage, was für eine Schriftstellerin ich bin: eine russische.
Ich denke oft daran, dass ich noch vor einem Monat oder einem Jahr ohne Weiteres in der Metro oder Tram neben einem von denen hätte sitzen können, die heute in der Ukraine kämpfen und dort unschuldige Menschen töten. Auch mit ihnen verband und verbindet mich also ein gemeinsames wir – das schnelle, situative wir des gemeinsamen Raums, eines Metro-Waggons oder eines Platzes in der Stadt, das wir der gemeinsamen Sprache, die einmal mehr niemanden hindert, den anderen umzubringen. Dieses wir, von dem ich spreche, besteht aus Millionen disparater Biographien und Strategien, die gegenüber der allgemeinen Schuld, dem allgemeinen Unglück, der allgemeinen Katastrophe nicht ins Gewicht fallen. Zu diesem wir zu gehören ist qualvoll – aber vielleicht ist es das Einzige, was derzeit Sinn hat: Das getane Böse muss ausgeglichen und der Ort, von dem es ausgeht, wieder bewohnbar gemacht werden, die Sprache, die es spricht, muss sich verändern. Vielleicht wird das Stigma, das schmerzhafte Zeichen der kollektiven Mittäterschaft eines Tages zu dem Punkt, an dem der Weg von einem blinden „Wir“ zu einer Gesellschaft der sehenden „Ichs“ beginnt. Bewerkstelligen lässt sich das nur von innen.
Maria Stepanova, 1972 in Moskau geboren, ist Schriftstellerin, Lyrikerin und Essayistin. Auf Deutsch erschien zuletzt ihr Gedichtband „Der Körper kehrt wieder“.
Aus dem Russischen von Olga Radetzkaja.
7 notes
·
View notes
Text
Dracula und sein Schatten

Stoker porträtiert Dracula in seinem gleichnamigen Roman als ein Wesen, das keinen Schatten wirft.
Und doch ist er umgeben von ihnen: Vor allem bei Jonathan Harkers Ankunft in Transsylvanien und im Schloss des Grafen beschreibt Stoker eine Welt voller Schatten, Dunkelheit und Zwielicht, die die bedrückende und bedrohliche Atmosphäre unterstreichen, der Harker ausgeliefert ist. Noch mehr löst der fehlende Schatten seines Gastgebers Misstrauen und Unbehagen in ihm aus.
Der junge Anwalt, der sonst rational handelt und von Regeln und Ordnung überzeugt ist, zweifelt allmählich an der Realität und an den Naturgesetzen seines vertrauten Weltbilds. Harker starrt immer eindringlicher auf seinen eigenen Schatten, um sich zu versichern, dass die gegebenen Naturgesetze noch gelten.
Diese Zweifel an der Logik und der Aufrechterhaltung der bekannten Normen sind eine übliche Methode der Schauerliteratur und übernatürlichen Literatur, um Spannung zu erzeugen.
Durch seinen fehlenden Schatten rückt Dracula in den Raum des Übernatürlichen und Unmenschlichen und positioniert sich als das bedrohende Andere. Dadurch scheint er für Harker nicht greifbar und keine reale Person zu sein; aber auch für Leser:innen, für die ja dieselben Gesetze gelten wie für den Protagonisten.
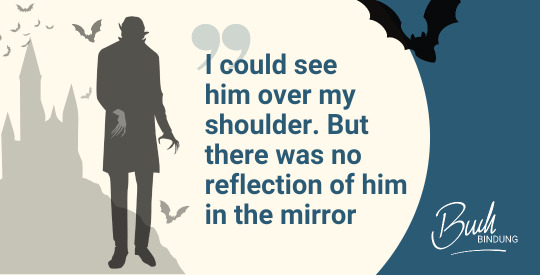
Ebenso besitzt Dracula keine Reflektion im Spiegel, die normalerweise identitätsstiftend ist: Der Graf scheint ohne Schatten und ohne Reflektion kein eigenes Selbst zu besitzen.
Das wird auch in seinem bestialischen Verhalten deutlich, wenn er das Blut seiner Opfer trinkt, sich die Identitäten der Menschen einverleibt, um selbst zu überleben - zu existieren.
Obwohl Dracula umgeben ist von Schemen und Dunkelheit, findet er wegen seines fehlenden Schatten weder in dieser „Schattenwelt“ noch in der irdischen, menschlichen Welt einen Platz und ist dazu verdammt, sich ruhelos zwischen diesen Welten zu bewegen.
Auch das verstärkt seine Position als bedrohliche Instanz, die für den logischen Menschenverstand nicht erklärbar ist. Auffallend ist seine selbstbezeugte Affinität zu Schatten und zur Dunkelheit, wenn er beteuert: „I love shade and shadow“.
Einerseits nutzt er die undurchsichtigen Merkmale der Dunkelheit und des schummrigen Lichts für seine Zwecke aus, andererseits ist er fasziniert von etwas, das er selbst nicht besitzt und auch nicht erreichen kann: einen eigenen Schatten zu werfen - und damit menschlich zu sein.
Auch das Spiel von Licht und Schatten, von Tag und Nacht, und die Umkehrung dieser beiden Zeiten machen es deutlich, dass sein "Gast" Jonathan Harker in einer anderen, verkehrten Welt erwacht. Er zweifelt an seiner visuellen Wahrnehmung, wenn er Dracula sich wie eine Echse die Schlossmauer entlang bewegen sieht, und hält dies im ersten Moment für einen Trick des Mondlichts oder für einen seltsamen Schatteneffekt.
Verstärkt wird dieser Eindruck auch durch durch seine bloße nächtliche Existenz seit seiner Ankunft im Schloss und die ausschließlichen Begegnungen mit dem Grafen bei Dunkelheit oder Nacht.
Ebenso wie sein Tag-/Nacht-Rhythmus ist auch sein Glaube an die Wissenschaft verkehrt worden. In seiner Hilflosigkeit und Unsicherheit versucht er daher, Aberglaube und Wissenschaft zu vereinen.
Nicht nur Draculas abnormale Existenz - ohne eigenen, nur zwischen fremden Schatten - beeinflussen Harkers Verstand, sondern auch die unvertraute Landschaft, in der er sich wiederfindet.

Das unbekannte, dunkle Transsylvanien ist ihm durch die unvertraute Sprache, aber auch durch den ländlichen Aberglauben fremd. Trotz der Wegbeschreibungen der Einheimischen hat er Schwierigkeiten, das Schloss ausfindig zu machen und ist völlig orientierungslos, da seine Umgebung in Schatten und Zwielicht versinkt.
Stoker bedient sich sowohl des Licht- und Schattenspiels als auch der Abwesenheit eben jener Schemen, um den Einfluss der Umgebung auf die menschliche Psyche darzustellen.
#book quotes#dracula#bram stoker#bram stokers dracula#vampire#gothic horror#supernatural literature#schauerliteratur#german blog#buchtipp#buchblogger#buchzitat#vampirgeschichte#english literature#irish literature#englische literatur#literatur#bücher#buchempfehlung#buchblog#gothic fiction#victorian literature#viktorianische literatur
2 notes
·
View notes
Photo

Sep. 21, 2022
contains Violence, Strong Language
Sie fuhren an einem lauen Sommerabend zur Dämmerung über den verlassenen Highway, im rötlichen Licht des Sonnenuntergangs. Im Radio liefen alte Songs, er sah zur Seite und lachte über einen Witz, den sie riss.
"Der war sowas von cheesy, außerdem kannte ich den schon."
'Na und? Wer lacht denn gerade darüber, hm? Hast du dir inzwischen überlegt mit mir zu dem Konzert zu fahren?'
Beccas Augen schauten ihn mit großer Erwartung an.
"Sogar wenn du mir den Witz des Jahres erzählst: Nah. Fahr mit deiner Schwester hin, ich besorge euch VIP-Karten. Wenn ich mitkäme müsste ich mir beide Ohren abschneiden, das gäbe nur ne furchtbare Sauerei."
Eigentlich wollte sie ihn tadeln aber konnte sich nicht verkneifen zu lachen über sein dämliches Gerede.
'Du bist so ein elender Mistkerl.'
"Darauf stehst du doch?"
'Tja, wahrscheinlich.'
Die Laune verderben ließ sie sich jedenfalls nicht von dem ihr angetrauten Mistkerl neben sich. Sie drehte lächelnd das Radio lauter und lehnte sich bequem in den Sitz, während in der Ferne die Skyline von New York sich vor ihnen auftat. Ein unklares, leicht verschwommenes Bild, verursacht durch Hitzeflimmern am Horizont. Ein lauter Knall aus der Luft störte die friedliche Idylle. Ein Düsenjet durchbrach unmittelbar über ihnen die Schallmauer und ebenso schlagartig änderte sich die Atmosphäre, die warmen Rottöne wichen einem kühlen, violetten Licht. Das letzte Überbleibsel vom Tag, die letzte Stunde vor der Dunkelheit. Das war kein Düsenjet, sondern ein anderes, übermenschlich schnell fliegendes Objekt, er bezeichnete sich selbst als 'only man in the sky'. Umso gemächlicher, als hätte er alle Zeit der Welt, senkte er sich nun schwebend vor der Motorhaube nieder und brachte den Wagen zum stehen, indem er nur die Hand ausstreckte. Er absorbierte die gesamte Wucht des Aufpralls durch seine Handfläche, was das Auto und seine Insassen gänzlich unbeschadet ließ, Naturgesetze traten außer Kraft in Gegenwart des stärksten Supes dieses Planeten.
-Sieh an, William Butcher und seine hinreißende Frau.-
Sein selbstgefälliges Grinsen war so widerlich, dass einem vom bloßen Anblick schlecht wurde.
'Butcher.'
MM rüttelte leicht an ihm, das Arschloch war unterwegs komplett weggeklappt und schuldete ihnen noch eine verdammte Erklärung.
-Vorsichtig, seine Schulter ist ausgerenkt, ich habe sie ihm gerade geschient.-
Mahnte Frenchie, der aus dem Bad zurückkam mit einem Paket Wundpflastern, Nadel und Faden, einer Pinzette, Wattepads und Desinfektionsmittel. MM ließ sichtlich angestrengt, genervt, von Butcher ab und ließ sich schwerfällig auf einem Sessel nieder.
'Der Penner. Als hätten wir nicht schon genug Scheiße an den Hacken, der öffnet die Schleusen und jetzt schwimmen wir bis zum Hals drin. Wer war das Mädchen bei ihm? Hast du gesehen wie viel Ambulanz da war? Feuerwehr und Cops im Anmarsch? Wären wir nicht zufällig vorbeigekommen..'
-Beruhig dich, ruf lieber Mallory an statt rumzumotzen. Wir müssen den Wagen zurückholen, und eine landesweite Fahndung stoppen.-
Frenchie bewahrte halbwegs die Fassung, obwohl er selber ziemlich gestresst war. Butcher hatte zuletzt sogar seinen eigenen Leuten oft übel mitgespielt, ihre Nerven und Geduld bis zum Anschlag strapaziert durch eigenmächtige Aktionen, die er im Alleingang verzapfte aber deren Konsequenzen die ganze Gruppe ausbadete. Nur Hughie hatte er noch wirklich auf seiner Seite und ausgerechnet der war nicht da, hatte anderweitig zu tun. Um diese Uhrzeit schlief er wahrscheinlich friedlich in Starlights Armen oder sie fickten gerade miteinander, so genau wusste niemand bescheid über ihre Schlaf- und Bettgewohnheiten.
-Lass mich nur machen, ich nähe ihn zusammen und du rufst die richtigen Leute an.-
Homelanders Hände steckten in roten Lederhandschuhen und er trug seinen blauen Heldenanzug, mit der amerikanischen Flagge als Cape. Dieses Grinsen wollte ihm ums Verrecken nicht vergehen als er um die Motorhaube herumschritt, zur Beifahrerseite.
"Ich warne dich, wage es bloß nicht.."
Homelander kicherte fast wie ein kleiner Junge. Wie niedlich dieser William reagierte als er in die Nähe seiner Frau kam. Er riss mit einer einzigen Bewegung die Beifahrertür ab, warf sie im hohen Bogen von sich und zerrte Becca an den Haaren aus dem Wagen.
-Was willst du denn dagegen tun, Menschlein? Ich gebe keine two fucks darüber was du willst oder nicht willst. Eigentlich könnte ich das euch zuliebe schnell über die Bühne bringen. Weißt du, ist nichts persönliches. Ich tue es weil ich es kann, weil ich der verfickte Homelander bin. Deine Frau stirbt, weil ich es so bestimme. Es gibt dort oben niemanden, der es verhindern könnte, ich bin der einzige Mann im Himmel. Und auf Erden gibt es niemanden, der über meinem Befehl steht. Verstehst du das, William Butcher, oder bist du womöglich schwer von Begriff?-
Während er seinen Monolog führte kam Butcher um den Wagen herumgestürmt, seine Brechstange in der Hand, und schlug mit ganzer Kraft von hinten gegen die Schulter und den Rücken des Supes. Das stählerne Brecheisen verbog sich unter den Schlägen und Homelander bemerkte es so gut wie gar nicht, dass jemand auf ihn einprügelte, es kitzelte ihn nicht einmal. Schulterzuckend rammte er Beccas Kopf gegen die A-Säule, sie blutete in Strömen aus Mund und Nase, wehrte sich verzweifelt aber vergeblich und wandte sich mit einer Bitte an ihren Mann, nachdem sie ihre ausweglose Situation erkannte.
'Billy, bitte verschwinde so schnell du kannst. Ich will nicht, dass du das siehst.'
-Billy, bitte bitte rette mich.-
Verspottete Homelander sie auf gehässigste Weise und brach ihr nacheinander die Beine. Aber Butcher konnte nichts von beidem, weder verschwinden noch seine Becca retten. Alles was ihm blieb war hilflos dabei zuzuschauen wie Homelander seine Frau lebendig in Stücke riss und sie am Ende mit seinen roten Laserstrahlen zu Asche verbrannte. Sein Zorn fraß ihn auf, er stand buchstäblich in Flammen vor Hass und schlug brüllend mit der inzwischen abgebrochenen Eisenstange unaufhörlich auf den Bastard ein, bis der keine Lust mehr hatte und vom Boden abhob, um davonzufliegen. Butcher blieb allein zurück und brach über dem Haufen Asche zusammen.
Er fuhr ruckartig hoch und spürte ein fieses Stechen in der Schulter, das ihn zurück auf den Rücken beförderte. Schweißgebadet, völlig neben sich, und das einzige was sich noch schlimmer anfühlte als die Schulter war der Schmerz in der Brust. Keine Folge des Unfalls, sondern seines Alptraums. Über ihm baumelte so eine alte, kitschige Schirmlampe, er kannte das Ding, das hier war MMs zweites Apartment und provisorischer Unterschlupf. Hierher kamen sie eigentlich nur, wenn die Scheiße in den Ventilator flog. Seine Erinnerung war lückenhaft, es benötigte zehn Minuten, bis sein Kopf den Abend rekonstruierte. Nachdem ihm alles wieder eingefallen war, hatte er es plötzlich sehr eilig. Sein Versuch von der Couch aufzustehen, ließ ihn mit dem Gesicht voran auf dem Boden landen. Er fluchte so laut, dass er Frenchie aufweckte, der auf dem Sessel pennte, auf dem vorhin MM noch gesessen hatte. Dieser war frustriert ins Bett gegangen vor einer Weile, und nachdem er ein paar Telefonate geführt hatte.
-Mon Dieu, shh, du weckst MM, und der ist nicht gut auf dich zu sprechen.-
"Frenchie, fahr mich ins Krankenhaus."
-Bist du auf den Kopf gefallen??-
Offensichtlich war er gerade eben hart auf den Kopf gefallen, ja.
"Ich erkläre dir das auf dem Weg. Keine Diskussion jetzt, fahr mich ins Krankenhaus, sofort."
Als sie dort nach einer knappen Stunde ankamen, war es bereits kurz vor Sonnenaufgang. Butcher hatte wie versprochen Frenchie während der Fahrt ein stückweit darüber aufgeklärt was passiert war und dass das Mädchen aus dem Wagen ihm wichtig war. Er kassierte Unverständnis und die berechtigte Frage, ob er sich das gut überlegt hat, noch jemandes Leben zu ruinieren. Butcher versicherte Frenchie, dass er ihn verstehen würde, wenn er sie erst kennenlernte. Das sorgte im Grunde für mehr statt weniger Zweifel bei seinem guten Freund, wenn für Butcher irgendwas unter 'persönliche Angelegenheit' fiel, wurde die Sache für gewöhnlich hässlich und ging auf ganzer Linie schief. Es war wie ein Fluch, was er berührte wurde zu Scheiße, selbst wenn er von guter Absicht dabei angetrieben wurde. Am Empfang der Klinik ließen sie sich was einfallen, damit sie auf die Intensivstation gelassen wurden, zumindest hatten sie für den Moment keinen Verdacht erregt und Butchers Gesicht war nirgends in den News zu sehen als flüchtiger Unfallfahrer. Wahrscheinlich hatte Mallory schon ihren Einfluss spielen lassen was das anging. Frenchie wartete auf dem Flur und Butcher betrat das Zimmer, wo das unbekannte, weibliche Unfallopfer lag. Die Schuld nagte gewaltig an ihm als er sie dort so liegen sah. Er rechnete nicht damit, dass sie schon aufgewacht war, ihre Kopfbewegung hatte er nicht vernommen und ihre Augen waren geschlossen, deswegen stand er anfangs schweigsam neben ihrem Bett und konnte nicht umhin den Blick über ihre Akte schweifen zu lassen, die offen neben ihr lag.
"I'm so sorry. Es tut mir leid, Liebes."
5 notes
·
View notes
Photo
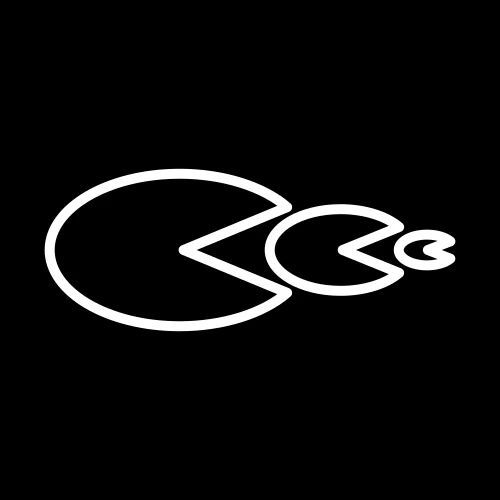
285 - Naturgesetz - Law of Nature #art #artwork #artproject #black #blackandwhite #characters #design #icon #icons #logo #masterpiece #mystery #sign #symbol #lawofnature https://www.instagram.com/p/CgtTPUloCGl/?igshid=NGJjMDIxMWI=
#art#artwork#artproject#black#blackandwhite#characters#design#icon#icons#logo#masterpiece#mystery#sign#symbol#lawofnature
2 notes
·
View notes
Text
Schattenspiele
Wo Licht ist,. dort ist auch Schatten. Aber es dürfen formschöne & tolle Schatten sein ;-)
Moin, moin zusammen. Manche von Euch haben es schon geahnt, dass die Tage dieses Thema kommt. Nämlich die unter Euch, welche mir auf meiner privaten Facebook Seite bzw. WhatsApp folgen.
Schattenspiele, es ist ja kein Geheimnis, dass ich Schatten mag, denn in der Regel ist es ein Naturgesetz, wo Licht ist, ist auch Schatten, 😉 deswegen bin ich meist ein Feind der schattenlosen Porträts, 😉 finde…

View On WordPress
#Aktfotos#Animalprints#besondere Fotos#erotische Porträts#Frauen#Geschenke#Schattenspiele#Tiermuster
2 notes
·
View notes
Text
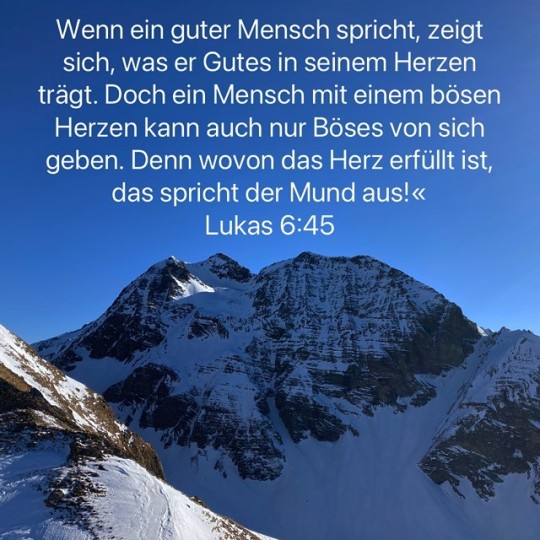
Kommt, lasst uns anbeten und uns niederbeugen, lasst uns niederknien vor dem Herrn, der uns gemacht hat! Psalm 95,6
Die christliche Anbetung, wie Gottes Wort sie uns vorstellt, entsteht im Herzen und kommt durch Worte zum Ausdruck. Wenn wir Gott anbeten, bringen wir Ihm göttliche Verehrung entgegen. Wir anerkennen Ihn als unseren Gott und bewundern seine Würde. Wir verehren seine Person und staunen über sein Tun.
Wir beten Gott als Schöpfer an. Wir staunen über seine Allmacht und Weisheit, die wir im Geschaffenen wahrnehmen können. Wie gross und weise ist unser Gott, der das Universum aus dem Nichts erschaffen und die komplexen Naturgesetze festgelegt hat! Was für ein wunderbarer Gott ist Er, dass Er den Menschen mit all seinen Besonderheiten gebildet hat!
Wir beten Gott als Erretter an. Wir bewundern seine Liebe zu uns Menschen, die Er in der Gabe seines Sohnes völlig unter Beweis gestellt hat. Wir stehen vor der Tatsache still, dass Gott den Herrn Jesus nicht verschont, sondern zu unserer Rettung in den Tod gegeben hat. Wo ist ein Gott, der die Menschen auf eine so wunderbare Weise geliebt hat!
Wir beten Gott als Vater an. In seinem Sohn, der Mensch geworden ist, hat Er uns sein Herz offenbart. Darum wissen wir, wie viel Ihm sein geliebter Sohn bedeutet. Das führt uns dazu, unserem Gott und Vater die Herrlichkeiten seines Sohnes vorzustellen. Wir rühmen vor Ihm, wie vollkommen der Herr Jesus in seinem Leben und in seinem Tod war. So beten wir den Vater an.
Mehr unter https://leselounge.beroea.ch/tagesandacht/#2024-04-28
0 notes
Text
Der grünen Schlacht für die Windkraft fallen Mensch, Natur und Wirtschaft zum Opfer
Tichy:»Die Ampel kämpft für die Windkraft und somit gegen die Naturgesetze. Nun kämpft sie auch gegen den Windkraftausstieg Frankreichs: Präsident Emmanuel Macron setzt wieder auf Atomkraft, um Energie zu gewinnen – denn die ist günstig und emissionsarm. Die Ampel setzt hingegen auf „erneuerbare“ Energien wie die Windkraft. Sämtliche Atomkraftanlagen und mehrere Kohlekraftwerke in Deutschland sind
Der Beitrag Der grünen Schlacht für die Windkraft fallen Mensch, Natur und Wirtschaft zum Opfer erschien zuerst auf Tichys Einblick. http://dlvr.it/T5pNGk «
0 notes